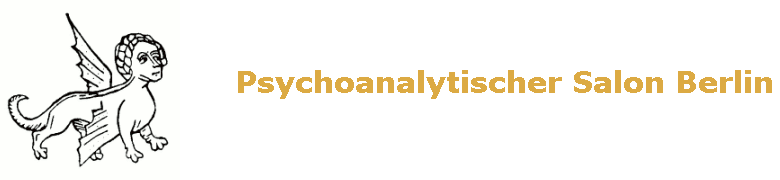
Eröffnungsvortrag von Susanne Lüdemann
Zur Eröffnung der Berliner Gruppe für Psychoanalyse
Unter den Antworten – Zu- und Widersprüchen, Nachfragen usw., die wir auf unseren Schrieb erhalten haben, hat uns eine, wiederkehrende, besonders überrascht. Mal behutsam formuliert als Nachfrage, mal als Unbehagen artikuliert, einmal auch als schon sexistisch zu nennender Anwurf daherkommend: Ob es damit eine besondere Bewandnis habe, daß dieser Schrieb von vier Frauen unterzeichnet sei? Ob dies „Absicht“ sei? Enttäuschter schon: Man fände dies „schade“, „bedauerlich“, „schöner“ wäre es doch anders gewesen – wichtig zu erwähnen, daß diese Äußerungen von männlichen wie von weiblichen Adressaten zu hören waren. Singulär schließlich, aber dennoch zum Nachdenken Anlaß gebend, die Äußerung von einem, der offensichtlich schon die bloße Tatsache, für einen möglichen Adressaten dieses Schriebs gehalten zu werden, beleidigend fand: Und außerdem, so das Ende einer längeren Suada, lasse er sich nicht von vier Frauen erklären, was Psychoanalyse sei.
Signifikant zunächst, daß das Fehlen männlicher Eigennamen unter dem Schrieb, sofern es überhaupt angesprochen wurde, als Mangel angesprochen wurde. Keine einzige Äußerung in diesen angeblich doch so frauenfreundlichen Zeiten, die, der gleichen Unterstellung der Bedeutsamkeit dieses Fehlens folgend, es als Positivum genommen hätte: Wie schön, daß auch auf dem psychoanalytischen Feld die Frauen endlich das Wort ergreifen o.ä. Psychoanalyse und Feminismus, so meint man zu wissen, das geht nicht zusammen; die Psychoanalytiker, und Lacanianer allemal, das sind die, die’s mit dem Namen-des-Vaters halten, die vor ihm haltmachen und (sich) an ihm festhalten. Und in der Tat liegt die Versuchung nahe, die artikulierte Enttäuschung über das Fehlen männlicher Eigennamen unter unserem Schrieb als Enttäuschung über das Fehlen eines wenn schon nicht wirklichen, so doch wenigstens möglichen, potentiellen Vaternamens zu deuten. Der im übrigen flugs wieder hinzugesponnen oder hineingelesen wurde in Äußerungen wie der folgenden: Man merke schon, aus welcher „Schule“, aus welchem „Stall“ gar, diese vier Frauen kämen. Im Namen des Vaters, der Töchter und des Heiligen Geistes, Amen.
Wenn die Psychoanalyse indes eine „Schule“ wäre – auf die Frage des „Stalls“ komme ich noch zurück -, eine „Schule“, in der man nichts lernte als „wie der Vater“ zu sprechen, dann wäre das wenig. Ein schlechter Vater, der nichts im Sinn hätte als Schule zu machen, und die Geschichte der psychoanalytischen Bewegungen mit ihrer langen Liste von Gründungen, Sezessionen, Exkommunikationen, Neugründungen und Abspaltungen zeigt, daß „Schule machen“ und „Psychoanalyse machen“ nur gegenstrebig sich fügen, um das Mindeste zu sagen. Mit diesem Widerspruch von „Schule“ und „Psychoanalyse“ hat zu tun, wer immer auf diesem Feld einen Versuch unternimmt, der über Couch und Sessel oder das Treiben privater Arbeitsgruppen hinausgeht – also auch wir.
Sagen wir vorläufig: Die „Schule“ ist eine Institution, die Psychoanalyse nicht. Die Institution bedarf eines konsistenten, will sagen: eines vom jeweiligen Sprecher ablösbaren, wiederholbaren Diskurses, die Psychoanalyse kann nicht nur, sie muß darauf verzichten (darin eher der Literatur vergleichbar als der Wissenschaft, in keiner von beiden aufgehend). Wenn in der Psychoanalyse überhaupt ein „Lernen“ stattfindet, dann wäre es eher als ein „Verlernen“ zu bezeichnen: Verlernen von Ansprüchen, Verlernen vermeintlicher Gewißheiten, Verlernen imaginärer Identifizierungen. Verlernen konsistenter Diskurse über Gott und die Welt, einschließlich des psychoanalytischen. Wie anders wäre etwas in Fluß zu bringen, was sich fixiert hat, wie anders wäre Veränderung zu erreichen?
Lacan hat seiner Rede den Namen einer „Lehre“, eines enseignement gegeben, und die Ecole Freudienne de Paris hieß nicht von ungefähr eine „Schule“. Dieser Anspruch Lacans legitimiert bis heute ein „Begehren der Schule“, das sich in Vereinsnamen und -zwecken niederschlägt wie dem von „Lehre und Forschung“ (das ist die Formel der Universität, die sich zum Beispiel auch in der Satzung der FLG neuerdings wiederfindet), ein „Begehren der Schule“, das natürlich auch alle Fragen der Ausbildung und das konfliktträchtige Ritual der passe berührt. Lacan hat allerdings auch nicht gezögert, seine „Schule“ aufzulösen, als die Effekte der ihm angetragenen oder unterstellten imaginären Vaterschaft begannen, alles zu verkleben, als das „Machen“ der Schule das „Machen“ von Psychoanalyse zu blockieren drohte. Lacans größter Irrtum bestand vielleicht darin, zu glauben, mittels der „Lehre“ die Klebe-Effekte imaginärer Vaterschaft kontrollieren oder umwenden zu können – gegen die, die darauf bestanden und bis heute darauf bestehen, ihn als Vater „gehabt“ zu haben, war er machtlos.
Wie also umgehen mit dem Namen-des-Vaters? Wie artikulieren das Verhältnis von Begehren und Institution?
Bernd Arlt-Niedecken vom Hamburger „Lehrhaus“ hat uns geschrieben: „Die Gründung einer Institution scheint mir der Versuch zu sein, die Existenz zu erhalten, wenn das Begehren zu erlöschen droht. Wenn die Art der Institution es erlaubt, dieses Problem zu überspringen, dann ist sie für die Psychoanalyse ohne Belang.“
„Die Gründung einer Institution scheint mir der Versuch zu sein, die Existenz zu erhalten, wenn das Begehren zu erlöschen droht.“ Ich lese hier den Vorschlag, die Gründung einer Institution als eine Art Symptombildung zu betrachten. Also als Kompromißbildung. Drückt sich darin zum einen der Wunsch nach Vergesellschaftung aus, also nach wechselseitiger Anerkennung eines je vereinzelten und vereinzelnden Begehrens, so schlägt die Institution doch gerade das Vereinzelnde des Begehrens in der Regel mit Schweigen: Die Homogenisierung des Diskurses, der das Begehren der Subjekte legitimiert und stabilisiert, bedeutet in der Regel den Ausschluß des Inkommensurablen, Absonderlichen und Kontingenten eben desselben Begehrens, um dessentwillen die Gründung unternommen wurde. Als verdrängtes hält es den Apparat in Gang (erhält es „die Existenz“), aber für eine psychoanalytische Institution, in der Tat, ist das wenig: Es läuft Gefahr, die „Lehre“ in ein Instrument der Abwehr zu verwandeln, bis sie schließlich nur noch dazu dient, die Verdrängung aufrechtzuerhalten und die Widerstände zu verstärken. Die Rezitation Lacanscher Formeln bedeutet als solche noch keinen Vorsprung vor dem unbewußten Phantasma.
Neben dem Begehren der Schule scheinen psychoanalytische Vereinigungen besonders geplagt vom Begehren des Familialen. Freuds „Mittwochsgesellschaft“, die Psychoanalytische Vereinigung, die EFP – sie alle setzten ihre Gründer als Familienoberhäupter ein. Die Referenz auf die Sache wird so mit der Referenz auf den Namen in eins gesetzt. Als Freudianer, Lacanianer, Jungianer oder was auch immer fühlt man sich offensichtlich einem Programm verpflichtet, das den NAMEN eines menschlichen Körpers unter fortwährendem Einbedenken DER WAHRHEIT mit einem TEXT verschmilzt: Man liebt Lacan, man liebt seine Botschaft, der Text und der Körper sind eins. Der Glaube freilich, der Eigenname des Gründers bürge für den Zusammenhalt einer Bewegung, die sich auf ihn beruft, einer Institution, die in seinem Namen Gesetze macht für die Weitergabe des Wissens und der Praxis, dieser Glaube ist schiere Illusion, in nichts von der religiösen Illusion unterschieden. In dem Maße, wie die Psychoanalyse eine Sammlungsbewegung um einen Namen herum möglich macht, entgeht sie nicht der Kritik der Ideologie. Ich zitiere René Major: „Wenn man aus dem Eigennamen einen alles vereinigenden Signifikanten macht, kann daraus schlicht ein Delirium hervorgehen. Und wenn man meint, mit dem Stückchen Wahrheit, das der Auserwähltheit eignet, d.h. der Wahl des Analytikers und der Wahl durch den Analytiker“, wenn man meint, mit diesem Stückchen Wahrheit „ließen sich die Phantasmen der analytischen Gemeinschaft konstruieren und dekonstruieren oder gar die Illusionen – wenn nicht die Obszönität – auflösen, die dem bloßen Ankleben von Namen entspringen, dann kann so etwas nur gelingen durch beständige Zurücknahme der Namen, d.h. durch Entzug des verbindenden Elements.“
Die „Berliner Gruppe für Psychoanalyse“ versucht einen solchen Entzug. Die Unterstellung eines gemeinsamen „Stalls“, aus dem wir kämen, nebst zugehörigen „Geruchs“ womöglich, mag in diesem Sinne als „Entzugserscheinung“ gelten. Wer hier was riecht, der möge sich an die eigene Nase fassen (anstatt, wie auch geschehen, von uns zu verlangen, wir möchten doch bitte „ein Zipfelchen raushängen lassen“). Die Psychoanalyse ist keine „Schule“ (schon gar nicht „fürs Leben“), und sie ist auch keine Züchtungsanstalt für Rasse-Lacanianer. Hinter den Eigennamen, mit denen wir unterzeichnet haben, hinter unseren Namen also, andere Namen zu vermuten, die als „verbindendes Element“ zugleich geheime Namen der Psychoanalyse, mindestens hier in Berlin, sein könnten, bedeutet, eine imaginäre Genealogie, einen imaginären Stammbaum herzustellen: Signifikanten aus anderen Signifikanten abzuleiten, die nicht genannt werden. Wes Interesse auf das Schnuppern von Stallgeruch, das Genießen imaginärer Genealogien und phantasmatischer Zugehörigkeiten gerichtet ist, der wird jedoch, so fürchte ich, hier enttäuscht werden. Wenn es eine besondere Bewandtnis damit hat, daß unser Schrieb, so, wie er ist, von uns als vier Frauen unterzeichnet wurde, dann vielleicht die, daß Frauen in patriarchalen Gesellschaften ohnehin nur beschränkte Möglichkeiten haben, sich in imaginäre Stammhalterschaften hineinzuphantasieren. Vielleicht sind sie von daher einfach nicht so scharf auf Genealogien – sie kommen ohnehin nur als Tauschobjekte darin vor.
Was für manche einen enttäuschenden Mangel an Übertragungsmöglichkeiten bedeuten mag, eine mangelnde Möglichkeit, das Begehren des Namens, der Schule und des Familialen (des „Stalls“) zu befriedigen, könnte, positiv gewendet, aber auch neue Arbeitsmöglichkeiten eröffnen. Insofern die Psychoanalyse Begehren nach dem Vater ist (was sie wohl tatsächlich immer auch ist), ist sie, mit einem Wort von Karl Kraus, selbst die Krankheit, von der zu heilen sie vorgibt. (Das war natürlich als Verdikt gegen die Psychoanalyse gemeint, ist aber, genau besehen, keins.) Ich habe Schwierigkeiten mit psychoanalytischen Institutionen, die das Begehren nach dem Vater schlicht als Schmieröl benutzen, also als Institution denselben infantilen Anspruch hemmungslos bedienen, denen die „Lehre“ ihnen zu frustrieren gebietet und den sie als einzelne, in ihrer Praxis, wohl auch frustrieren mögen.
Die Frage ist, ob Institutionen ohne dieses Schmieröl überhaupt funktionieren können. Wenn die Art der Institution es erlaubt, diese Frage zu überspringen, dann ist sie – darin stimme ich Bernd Arlt-Niedecken zu – „für die Psychoanalyse ohne Belang“. Wie also umgehen mit der Tatsache, daß die psychoanalytische Institution ein Widerspruch in sich ist, ohne daß die Psychoanalyse deswegen „Privatsache“ wäre?
Wir haben uns – Eva Jobst hat es bereits gesagt – für eine relativ offene Form entschieden, die das level der Institutionalisierung so niedrig wie möglich hält. Das heißt zunächst, daß wir nicht vorhaben, uns als Verein bürgerlichen Rechts zu konstituieren. Wir verzichten auf Satzung und Statuten. Sie können also hier auch nicht Vereinsmitglied werden. Wir machen, anders gewendet, von unserem Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Gebrauch, ohne uns dem Vereinsrecht zu unterstellen, d.h. derjenigen Beziehungsregel, die der Staat seinen Bürgern für die „Persönlichkeitsverwirklichung in Gruppenform“ (so heißt das) zur Verfügung stellt. Wir konstituieren uns somit auch weder als Körperschaft noch als Rechtssubjekt. Die anvisierte Form der Öffentlichkeit ist vielmehr eine, die die Einzelnen als Einzelne versammelt oder sich versammeln läßt, die also die „Zwecke“ oder das Begehren dieser Einzelnen auch nicht einem satzungsgemäß und in den rechtlich vorgeschriebenen Formeln artikulierten „Vereinszweck“ unterstellt. Uns scheint das eine Form der Öffentlichkeit zu sein, deren Fruchtbarkeit unter den gegenwärtigen staatlich-gesellschaftlichen Verhältnissen geradezu systematisch ausgetrocknet wird: Räume zwischen privatem Familienidyll oder Beziehungselend auf der einen Seite und Kleingartenkolonie e.V. auf der anderen gibt es praktisch nicht oder jedenfalls werden sie nicht in Anspruch genommen. Räume, in denen das Sprechen der Einzelnen das Sprechen der Einzelnen bleibt, ohne darum als rein private Meinungsäußerung gelten zu müssen. Wir versuchen, einen solchen Raum neu zu schaffen oder wiederzubeleben, was sicher ein prekäres Unterfangen ist. Die einzige Regel, die wir uns geben, ist die zeitliche Skandierung: der jour fixe an jedem ersten Freitag im Monat. Was an diesen Freitagen stattfindet – Vorträge, Diskussionen, Lesungen – und was davon abzweigt – Seminare, Arbeitsgruppen – hängt vom Begehren derer ab, die teilnehmen mögen. Sie alle sind zur Mitarbeit herzlich eingeladen.
Berlin, den 6.2.1998