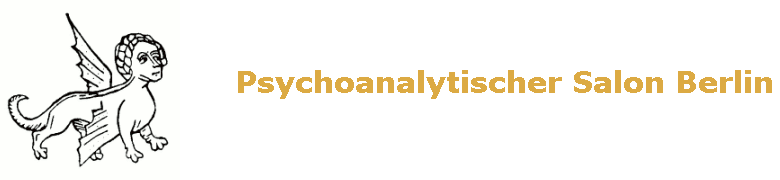
Der küstenhafte Rand, zu dem die Sprechwellen (nicht) gelangen
Masaaki Sato
Ich habe, wie andre Freunde hier, eine kurze Zeit zum Sprechen bekommen, und da die Zeit von Anfang an drängt, ist es vielleicht gerade günstig, meine Motivation, als ein Freund des psychoanalytischen Salons mitzuarbeiten, in Eile zu nennen.
Nachdem ich mich zur Rede hier gemeldet habe, hatte ich einen Traum, von dem ich gleich einen Ausschnitt erzählen möchte.
Ich war auf einer vertrauten Insel mit deutschsprachigen Bewohnern und habe einen Abgrund am Rand der Insel gesehen. Der Ort wurde gerade erschlossen, war eine riesige Baustelle, durch die eine bedrohliche Menge Wasser floss. Ich hörte meinen früheren Japanischlehrer auf Deutsch klagen, er sei extra hierher gekommen, um an einem anderen Ort weiter zu arbeiten, könne jedoch wegen der Baustelle nicht einmal die Küste sehen. Ich dachte, er würde das Erwartete nicht finden, und bin
weitergegangen und so verschwand seine Stimme im Tosen des fließenden Wassers.
An einem Ort, wo man das sucht, von dem man vorher schon wusste, dass man es dort finden würde, findet man es nicht. Denn in der Phantasie gibt es immer etwas, das gerade in deren Kern verschwindet. In der psychoanalytischen Baustelle geht es umgekehrt darum, wie man die voreingenommene Vorstellung verraten kann, dem fremden und entfremdenden Kontext begegnen kann. Der Weg zum Abfluss des verweilenden Wassers muss also gebahnt werden. Aber nach welcher Richtung?
Der Salon ist keine Institution, so sagen wir. So zu sagen, jedoch heißt noch lange nicht, es nicht zu sein. Wollen wir nicht der Wirkung der Verleugnung nachgeben. „In-stituere“, also „ein-richten“, passiert automatisch, wo man mit den anderen zusammenarbeitet, egal ob man will oder nicht. „Eine-Richtung“ wird besonders stark, wenn man das Analysieren eigener Identifizierung zur Seite schiebt, z.B. in der Form der „Sub-Stitution“ der eigenen Verantwortung für das Sagen durch gewisse theoretische Begriffe, bei deren Gebrauch man davon ausgeht, dass die anderen auch so verstehen würden. Die Zuneigungen zu bestimmten Denkrichtungen bzw. die Abneigungen gegen diese, die gleich Denkverbote mit sich bringen, könnten führen zur „Pro-Stitution“ mit der Hingabe zum Meister führen. Wo man eine Gruppe aufbaut, ist diese Gefahr ständig da, und wenn man von dieser Gefahr hinausgehen will, wird es riskant. Riskant, indem man in ein Gebiet eintritt, wo die Schützfunktion des Wissens scheitern kann. Weder eine Institut noch eine Nicht-Institut kann das Scheitern garantieren. Dieses Risiko ist mein kleines Träumchen hier.
Auch wenn ich in dieser Fremdsprache träume oder Lapsus mache, bin ich in der Tradition, in der die Psychoanalyse entstand, ein Fremder. Und ich erwarte nicht, in dieser fremden Tradition etwas zu gewinnen, sondern vielmehr etwas zu verlieren, mich mit meinem Verlust zu konfrontieren. Dabei bleibt allerdings jede Tradition und jedes Wissen dem Subjekt fremd, denn keinem Subjekt ist die Sprache angeboren, wie Jutta Prasse betonte, die freier von der Lacan-Autorität zu sprechen wusste. Das Wasser, das die klagenden Signifikanten zum Verschwinden bringt, wird die unsichtbare Küste überschreiten und ins Meer fließen, wo die Wellen durch die Schwelle des Strandes zu rauschen beginnen. Das Rand des Lochs im Wissen ist küstenhaft, littoral, in dem Sinne, wie es Lacan 1971 gleich nach seiner zweiten Japanreise sagte, dass nämlich ein Gebiet einem anderen gegenüber eine Grenze markiert, indem es diesem gegenüber so fremdartig ist, dass diese Gebiete nicht reziprok zueinander sind.
Diesem küstenhaften Rand gegenüber bekenne ich mich verpflichtet zu sein, indem ich hier spreche. Es war für mich sehr eindrucksvoll, was Mai Wegener bei einem Treffen sagte, dass es im Salon um die Institutionalisierung der Differenz geht, wenn von Institutionalisierung überhaupt die Rede sein kann. Aber um welche Differenz geht es hier? Ich möchte sagen, es ist die Differenz zwischen dem Wissen, das per Definition ein Fremdes ist, da das Symbolische immer für etwas anderes steht, und dem Nicht-Wissen. Und die Präsentwerdung dieser Differenz ist nicht ungefährlich. Nicht ungefährlicher als das Sprechen in der Analyse.
Die von der Spree geschützte Museumsinsel, zu der die kostbaren Schätze gelangten, erwarte ich nicht vom Salon. Die jedesmal neue und einmalige Erfahrung in den Museen hat ja einen unvergleichbaren Wert als Ort der Demonstration toten Wissens, das entweder täuscht oder langweilt. Wenn die Langeweile ein Ausdruck der Angst sein kann, ist es vielleicht die Angst vor dem Schwinden des Subjekts; d.h., die anderen zu langweilen, das kann sehr aggressiv sein. Sich von dieser Aggressivität fernzuhalten, so möchte ich sagen, ist ein wichtiges Moment der Ethik der Freundschaft.
Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich den Lacanschen Ansatz „n’importe quoi“ – „was, ist egal“ – auf den Salon erweitere. Ich interessiere mich dafür, wovon man spricht, aber ganz ehrlich gesagt, dieses Interesse ist sekundär. Sondern von woher, auf welche Weise man spricht, das möchte ich hören. Die präsenten Ohren, die der Salon durch das neue Setting weiter gewinnen wird, finde ich äußerst kostbar, so dass man nicht in der Phantasie, in der religiösen Privat- oder Sektentheorie, bleiben muss.
Dafür muss man aber viel sprechen. Sprechen in der Voraussetzung, dass man dabei in der Überraschung oder im Schreck etwas verraten kann. Was ich durch den Salon verlieren kann, darauf bin ich gespannt, und das ist meine Motivation für diese Teilnahme.