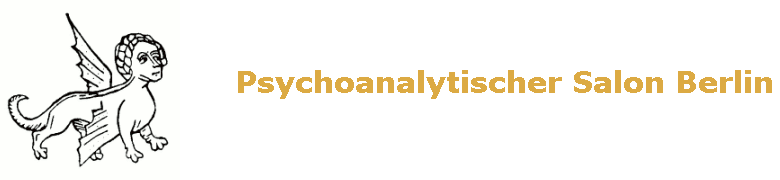
Eröffnungsvortrag von Mai Wegener
Berlin, 6. Februar 1998
Meine Damen und Herren –
daß die Psychoanalyse keine Privatangelegenheit ist – diesen Satz finden Sie in unserem Brief. Beinahe eine Selbstverständlichkeit: Die Psychoanalyse braucht öffentlichen Raum, Psychoanlytiker müssen veröffentlichen, öffentlich sprechen. Sie brauchen, kurz gesagt, Publikum. Publikum ist ein gutes Wort hier, es klingt ein bißchen anrüchig, nach Theater – eines mit Zwischenrufen wäre gut.
Dort wird dann von der Theorie gesprochen, Theorie, mithin Behauptung des Unbewußten. Der Erfinder der psychoanalytischen Theorie des Unbewußten, Freud, hat immer Publikum gebraucht (von ihm nehme ich das Wort) zur Ausarbeitung seiner Gedanken. Das war eine Bedingung fürs Schreiben. Seine Theorie erfährt dann mannigfache Umarbeitungen, Umschriften, die jeweils öffentlich dokumentiert werden.
Das Unbewußte ist vielleicht keine Erfindung – ich glaube allerdings auch nicht, daß es eine „Entdeckung“ ist – vielmehr braucht es Erfindung (und nährt solche), es bracht Konstruktion, Fiktion, um als solches theoretisiert, behauptet werden zu können: Signifikantengestöber, das ihm Rand gibt, seine jeweils besondere Kontur. – Ebenda kommen die Privatangelegenheiten ins Spiel. Und das auf dem theoretischen Feld! : Tatsächlich, die Intimität, die intimen Signifikanten, die jeweils für den Einzelnen das Unbewußte markieren, die Steppunkte, aus denen seine Konstruktion hält. (Was im übrigen nicht heißt, daß sie als intime von außen offen kenntlich sind.)
Daß die Intimität mit hineinmischt, ist etwas für das die literarische Fiktion offen ist. In der wissenschaftlichen hat sie gemeinhin nichts zu suchen.
Stellen Sie sich vor, ein wissenschaftlicher Text würde so beginnen:
Ich habe mir eine Aufgabe vorgenommen – zum Nutzen der Welt
und zur Freude edler Herzen,
jener Herzen, für die mein Herz schlägt,
und jener Welt, in die mein Herz blickt.
Die Welt der Mehrheit mein ich nicht
von der ich mir erzählen lasse,
daß sie kein Leid ertragen kann
und nur in Freude plätschern will –
Gott möge ihr das doch gewähren!
Dieser Welt und solchem Leben
wird mein Erzählen unbequem –
ihr Leben ist nicht eins mit meinem!
Von ganz anderen Menschen spreche ich,
die gleichzeitig in ihrem Herzen tragen:
Ihre süße Bitterkeit, ihr liebes Leid,
ihre Herzensfreude und ihre Sehnsuchtsqual,
ihr glückliches Leben, ihren traurigen Tod,
ihren glücklichen Tod, ihr trauriges Leben.
(Übers. kompiliert aus D.Kühn u. R.Krohn)
Das ist, Sie haben es vielleicht erkannt, aus dem Anfang von Gottfried von Straßburg’s Tristan-Fragment. Die Passage ist berühmt, über die „edlen Herzen“ ist viel gerätselt worden: Es taucht hier etwas Neues auf. Gottfried, der kein Adliger war, wendet sich in der Tat Anfang des 13.Jhd., wo der Tristan geschrieben ist, an ein neues Publikum, Stadtbürger und Gelehrte. Er setzt sich inhaltlich, vor allem aber stilistisch von vorangehenden Formen ab.
Ich werden Ihnen die Stelle jetzt noch einmal im mittelhochdeutschen Original vorlesen, das ist genauer und hier kommt, vielleicht auch wegen des Reims, der bemerkenswerte Chiasmus am Schluß stärker zur Geltung.
Ich hân mir eine unmüezekeit
der werlt ze liebe vür geleit
und edelen herzen z’einer hage,
den herzen, den ich herze trage,
der werlde, in die mîn herze siht.
ine meine ir aller werlde niht
als die, von der ich hoere sagen,
diu keine swaere enmüge getragen
und niwan in vröuden welle sweben.
die lâze ouch got mit vröuden leben!
der werlde und diesem lebene
enkumt mîn rede niht ebene.
ir leben und mînez zweient sich
. ein ander werlt die meine ich,
diu samet in eime herzen treit
ir süeze sûr, ir liebez leit,
ir herzeliep, ir senede nôt,
ir liebez leben, ir leiden tôt,
ir lieben tôt, ir leidez leben.
Und doch ist die Psychoanalyse mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit angetreten.
Daß die Psychoanalyse „auf einer ähnlichen Grundlage“ aufgerichtet sei „wie jede andere Naturwissenschaft, z.B. die Physik“ – Freud hat es so oft gesagt, daß man schon seine Zweifel bekommen kann, ob er sich denn seiner Behauptung so sicher sei. Lacan wird noch einmal nachsetzen, z.B. wenn er sagt, „daß das Subjekt mit dem die Psychoanalyse operiert, nur das der Wissenschaften sein kann“. Die Matheme, die Topologischen Übungen, all das wäre undenkbar, wenn es nicht diese Leidenschaft zur Wissenschaft gäbe, die der Psychoanalyse inhärent ist.
In der Psychoanalyse sind die Intimität und jenes Verhältnis mit der Wissenschaft, das sie unterhält, merkwürdig ineinander verschränkt. Unmöglich, sich hier auf eine Seite zu schlagen. Man hat keine Wahl.
– * –
„Liebster Freund“ heben viele der Briefe an, die Freud an seinen Intimus der Jahre 1887 bis 1901, den Berliner HNO Arzt Wilhelm Fließ geschrieben hat. Das war die Zeit der Anfänge der psychoanalytischen Erfindung, jene Zwischenzeit vor dem Erscheinen der Traumdeutung.
Man tauscht sich aus über die ärztliche Praxis und daraus hervorgehende Gedanken und Überlegungen; über Familiäres; die Geburten der Kinder; auch über Einsamkeit – über die eigenen körperlichen Leiden und Zipperlein, ebenso wie über die theoretischen Entwürfe. Freud, dessen Briefe die einzig erhaltenen sind, beginnt hier seine Gedanken und Vermutungen niederzuschreiben und auszuarbeiten, aus denen später die psychoanalytische Theorie werden wird, darunter die Analyse seiner Träume. Es wird, wie Sie wissen, Freuds Analyse gewesen sein.
1937 hat Marie Bonaparte diese Briefe von einem Berliner Antiquar erstanden. Fließ war zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben (1928). Seine Frau und Kinder, wie ja auch Freud, emigrieren zu verschiedenen Zeitpunkten aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Sie verkaufen die Briefe, um nichts bei sich zu haben bei der Ausreise, was sie kompromittieren könnte.
Als Freud 1937 von M.Bonaparte erfährt, daß seine Briefe in ihren Händen sind, gibt es einen Briefwechsel, in dem Freud die Veröffentlichung der Briefe zu verhindern sucht. Er schreibt unter anderem an M.B: “ Es ist mir natürlich recht, wenn auch Sie die Briefe nicht lesen, aber Sie sollen nicht glauben, daß sie nichts als schwere Indiskretionen enthalten; bei der so intimen Natur unseres Verkehrs verbreiten sich diese Briefe natürlich über alles Mögliche, Sachliches wie Persönliches, und das Sachliche, das alle Ahnungen und Irrwege der keimenden Analyse betrifft, ist in diesem Falle auch recht persönlich … „.
In diesen Briefen taucht die Rede vom Publikum auf.
Undzwar im Zusammenhang der Briefstellen, an denen Freud Fließ den Platz des Anderen zuweist: „wo ich den Anderen kaum entbehren kann und du der einzige Andere, der alter, bist.“ (21.Mai 94) oder: „Ich kann Dich aber, den Repräsentanten des „Anderen“, leider nicht entbehren und – habe wieder 60 Blätter für Dich“ (21.Sept.99). Die Einführung dieser Alterität schuf die Voraussetzung für Freuds Analyse und die Erfindung der Theorie des Unbewussten – was hier dasselbe ist.
Jetzt 2 Stellen mit Publikum:
„Ich hoffe, jetzt bist du wieder für lange Zeit der Alte und läßt Dich auch von mir als wohlgeneigtes Publikum weiterhin mißbrauchen. Ohne solches kann ich eigentlich doch nicht arbeiten.“ (16.5.97) und
„Ich bin so unendlich froh, daß du mir einen Anderen schenkst, einen Kritiker und Leser, und noch dazu von deiner Qualität. Ganz ohne Publikum kann ich nicht schreiben, kann mir aber ganz gut gefallen lassen, daß ich es nur für Dich schreibe.“ (18.5.98)
Das ist eine vernehmliche Entprivatisierung des Verhältnisses, eine Entpersönlichung von Fließ auch, der als Publikum ja auch öffentliche Person ist.
1900 veröffentlicht Freud dann die Traumdeutung, geschrieben tatsächlich für das öffentliche Publikum. Daß der Bruch mit Fließ in eben diese Zeit fällt, ist sicher kein Zufall. Das persönliche Verhältnis fällt aus, Freud wirft es raus.
„Es hat mir leid getan den „einzigen Publikum“, wie unser Nestroy sagt, zu verlieren. Für wen schreibe ich denn noch? Wenn Du also in dem Moment, da eine Deutung von mir Dir Unbehagen macht, bereit bist zuzustimmen, daß der „Gedankenleser“ nichts am anderen errät, sondern nur seine eigenen Gedanken projiziert, bist Du wirklich mein Publikum auch nicht mehr, mußt die ganze Arbeitsweise für ebenso wertlos halten, wie die anderen.“ (19.Sept.1901). Es war eine heftige Trennung.
In der Traumdeutung wird Freud erstmals die Grundzüge der psychoanalytischen Theorie durchbuchstabieren. Kein Intimus mehr, aber Intimität allerorten: Ein bißchen zu viel Wiener Dialekt (den streicht Fließ ihm noch raus), ein bißchen zu witzelnd – hier wird Freud Fließ, der ihm diesen Einwand machte, entgegnen: es ging nicht anders, die Schräglage ist von meinem Gegenstand verursacht – und gespickt mit unzähligen Privatangelegenheiten nicht nur von seinen Patienten, sondern von ihm selbst. Er analysiert immerhin unzählige seiner eigenen Träume.
Das Wissen vom Unbewussten übermittelt sich nicht ohne solche Einmischungen.
-*-
Das hat Folgen für die Theorie. Mit der Psychoanalyse ist kein konsistenter Diskurs zu machen. Anders gesagt: „Das systematische Bearbeiten eines Stoffes ist mir nicht möglich; die fragmentarische Natur meiner Erfahrung und der sporadische Charakter meiner Einfälle gestatten es nicht“ (Freud an Lou Andreas-Salomé) Die Stringenz, d.h. die Schnürung läßt zu wünschen übrig.
Und es hat Folgen für die Theoretiker, die in ihre Theorien anders verwickelt sind. Ihr Diskurs stützt sich nicht auf Körperschaften, er durchquert ihren Körper. Das gibt komische Figuren, oder einfach: das bringt Eigenheiten hervor. Wenn die, die mit der Psychoanalyse zu tun haben, dann mit Macht versuchen, nicht komisch zu sein, dann wird’s, find‘ ich, oft erst richtig komisch. (witzig ist das nicht unbedingt)
Berührt hat es mich doch, daß wir selbst so wahrgenommen wurden nach unserem Brief: komische Figuren, so 4 Frauen. Ob wir denn nicht wenigstens ein Zipfelchen raushängen lassen könnten? (- das ist bereits zitiert worden.)
– * –
Die Freud-Lacan-Gesellschaft läßt eine ganze Linie raushängen, wenn sie sich „in der Linie einer Arbeit“ plaziert, der Linie nämlich, die sie der Arbeit von Berliner Psychoanalytikern mit dem Werk Freuds und dessen Lektüre durch Jacques Lacan ab 1978 unterlegt.
Die Reihung der Vorgeschichte auf ihre Gründung hin kehrt wie ein Refrain wieder in ihren Präsentationen. Hier wird ein Verhältnis von Erbschaft instauriert, Besitzstandsicherung ist das.
Wo doch die Psychoanalyse vielmehr in einem Verhältnis von Leserschaft gründet, das immer mit Interpretation zu tun hat – und Zerlegung und Zerlesen, Verteilung und Differenzierung nach sich zieht, sofern hier der Signifikant als solcher – der Verzweigungsfaktor (wie Dieter Hombach ihn nennt) – einfällt, dazwischentritt.
Ich weiß nicht wie da eine Linie hereingebracht werden soll und ich werde mich auch nicht an solchen Versuchen beteiligen. Mit der Frage der Abkunft in der Psychoanalyse ist es doch eher eine Verlustgeschichte. Der Vater des Gedankens – und gedankliche Vaterschaft ist ja das, um das es hier geht – der Vater des Gedankens: es wird der Unbewusste Wunsch gewesen sein.
Diesen Moment, in dem aufblitzt, daß der, den das Subjekt für den Vater genommen hat, eben nur von ihm dafür genommen wurde, in dem also die Übertragung als solche hervortritt, habe ich an einer Stelle in meiner derzeitigen Lektüre – im Tristan – eingefangen gefunden.
Es ist die Passage am Hofe von Marke, als Tristan nach der Ankunft seines Ziehvaters (Rual li Foitenant) durch dessen Erzählung von seiner Abkunft erfährt: Von seinen Ziehvater, den er bisher für seinen Vater gehalten hatte, hört er, daß nicht er sein Vater ist, sondern ein anderer (Riwalin), der jedoch bereits und sogar schon vor seiner Geburt gestorben ist.
Ich möchte Ihnen die Stelle zum Schluß vorlesen. Es ist die Antwort Tristans:
Tristan sagte: ‚Ich bemerke,
daß diese Geschichte so beschaffen ist,
daß ich mich erst spät über sie freuen kann.
Ich habe wie ich so zuhörte,
erstaunliche Neuigkeiten erfahren.
Ich höre meinen Vater sagen,
mein Vater sei schon vor langer Zeit erschlagen worden.
Er entzieht sich mir in dem Moment.
Also muß ich ohne Vater sein,
obwohl ich zwei Väter bekommen hatte.
Ach Vater und Vaterglaube
wie seid ihr mir genommen!
Von dem ich bekannte, in ihm sei mir
ein Vater gekommen, von ebendem
werden mir zwei Väter genommen:
er und einer, den ich nie gesehen habe.‘
Tristan der sprach: ‚Ich hoere wol:
sich machent disiu maere alsô,
daz ich ir spâte wirde vrô.
Ich bin alse ich hân vernomen,
ze wunderlîchen maeren komen.
Ich hoere mînen vater sagen,
mîn vater der sî lang erslagen.
Hie mite verzîhet er sich mîn.
Sus muoz ich âne vater sîn,
zweier vetere, die ich gewunnen hân.
 vater unde vaterwân,
wie sît ir mir alsus benomen!
An den ich jach, mir waere komen
ein vater, an dem selben man
dâ verliuse ich zwêne veter an:
in unde den ich nie gesach.‘
Berlin, den 6.2.1998